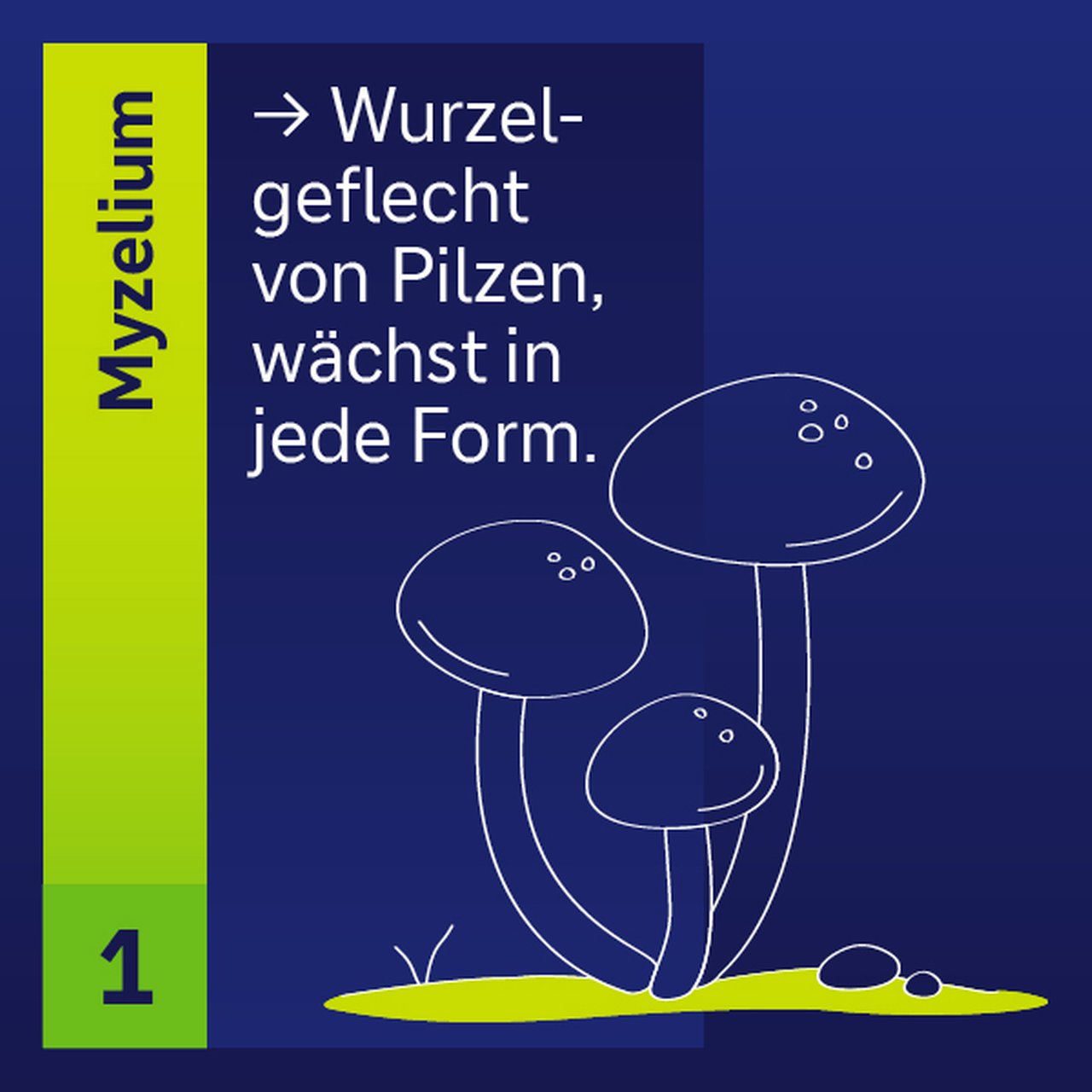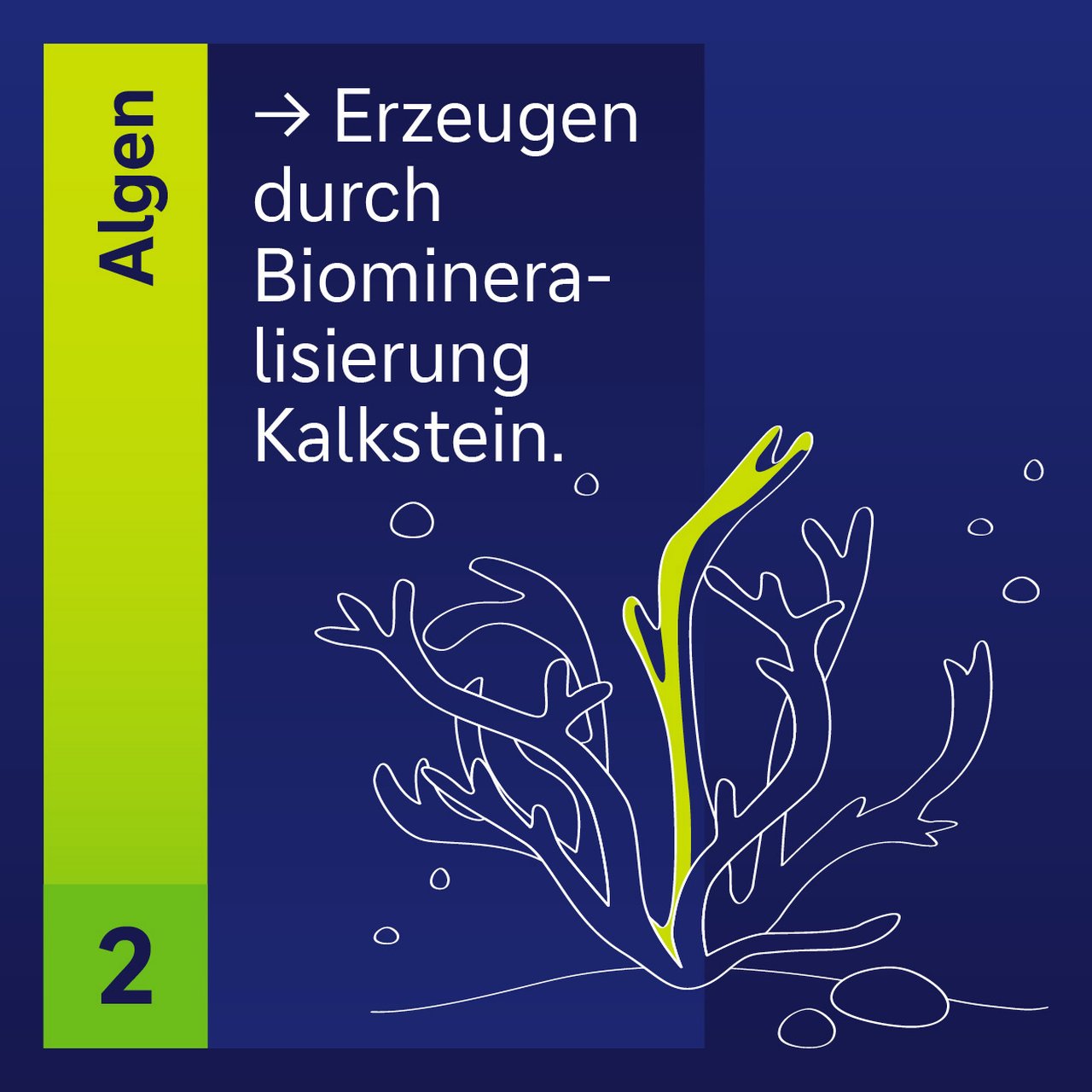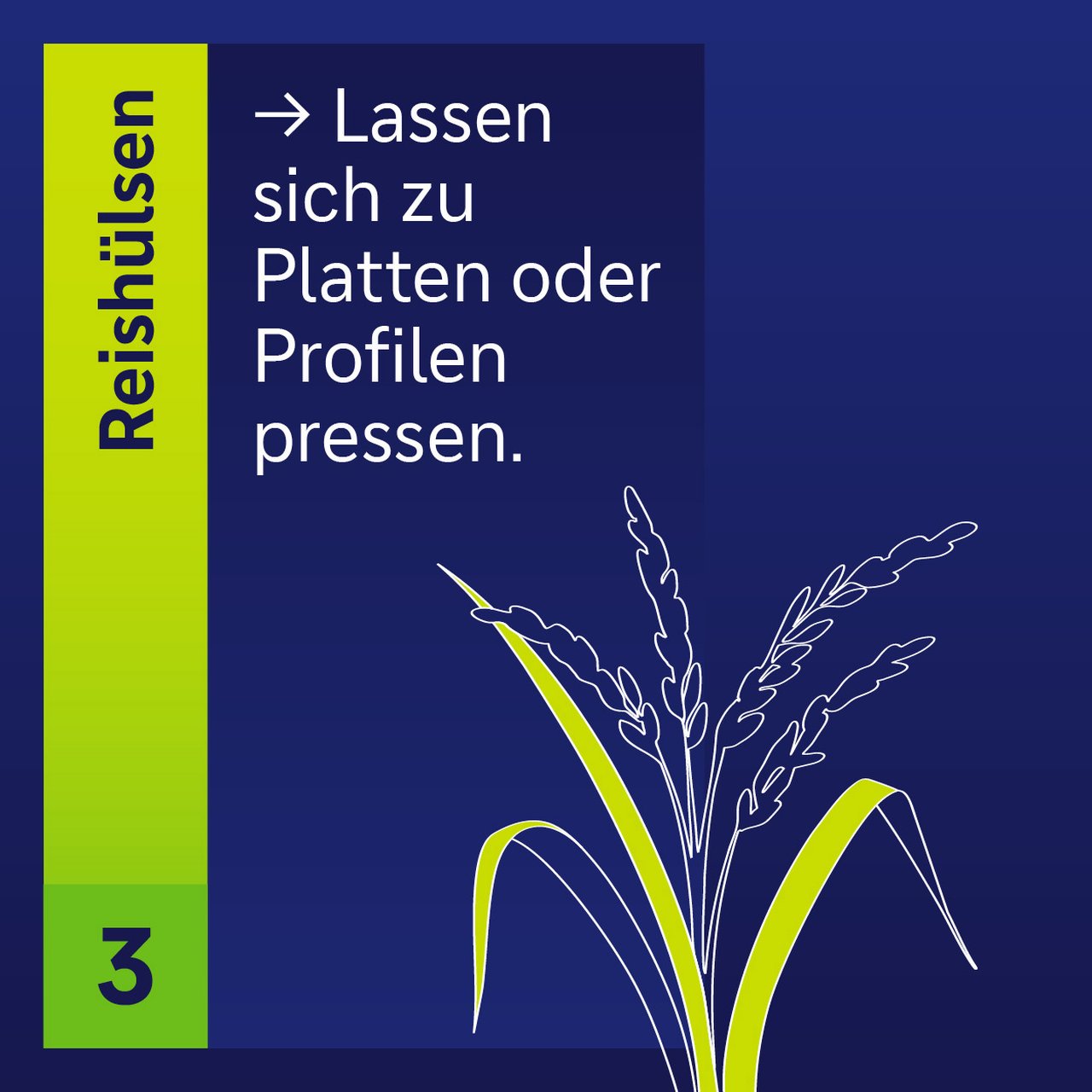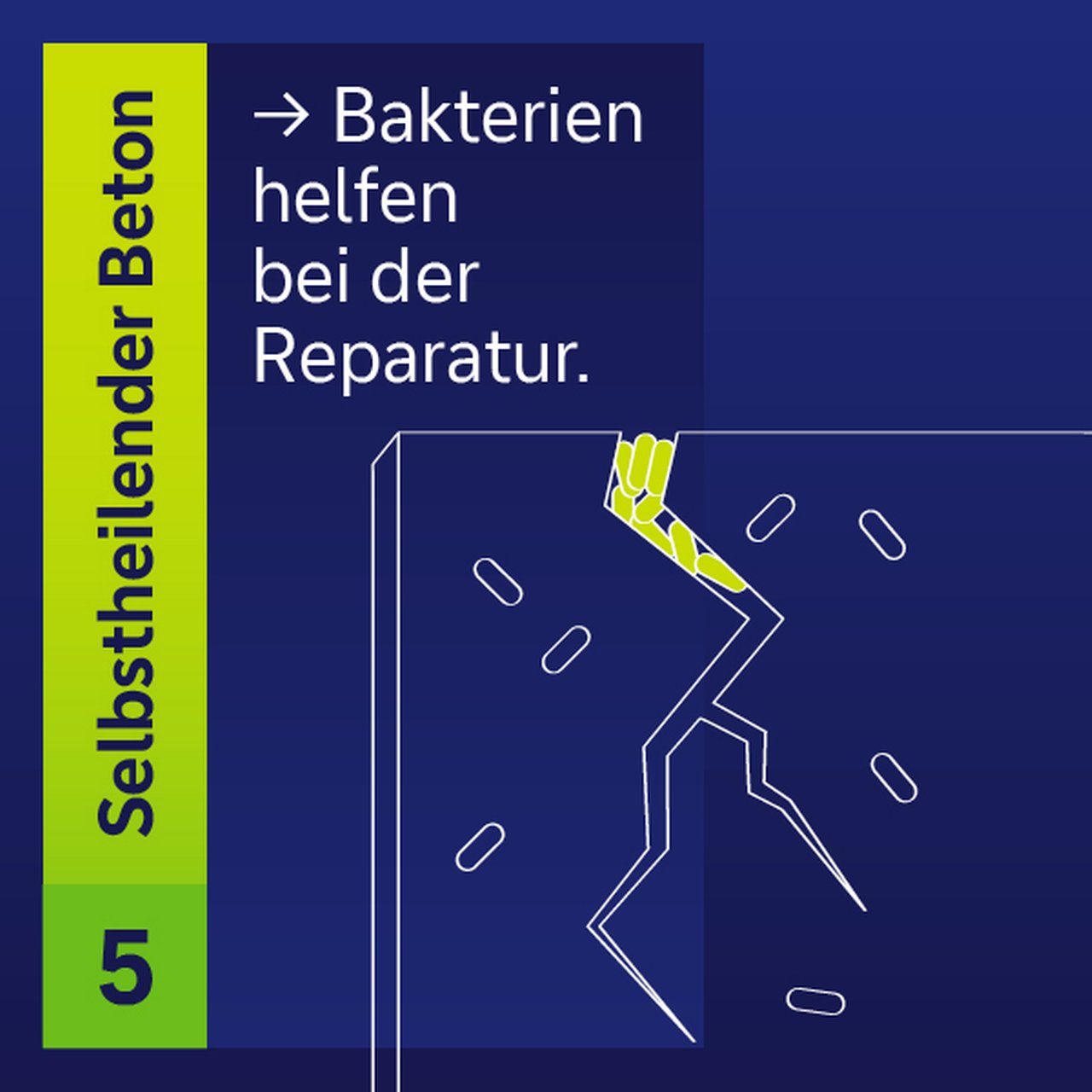Grüner wird’s nicht: Die Zukunft des Bauens wächst in Natur und Labor
Nachhaltiges Bauen kennt viele Ansätze, doch die spannendste Entwicklung findet bei den Materialien statt. Statt Beton und Stahl treten Pilze, Algen und Reis auf die Bühne. Was nach Science-Fiction klingt, wird bereits erforscht, getestet und gebaut.

Inspiriert von Hy-Fi, dem ersten Pilzturm der Welt.
Aus der Tiefe in die Höhe: Pilzgeflecht
Myzelium ist das unterirdische Wurzelgeflecht von Pilzen – ein Netzwerk aus feinen Fäden, das auf organischem Abfall wächst. Unter kontrollierten Bedingungen kann es in nahezu jede Form wachsen und sorgt damit bei Umweltpionieren, Architekten und Designern gleichermaßen für Begeisterung.
Myzelium punktet darüber hinaus mit weiteren, für die Bauwirtschaft wichtigen Eigenschaften: Dank der dichten Zellstruktur und des hohen Wassergehalts im Ausgangszustand ist es schwer entflammbar und schlägt mit Blick auf Schalldämmung sogar viele synthetische Stoffe.
Vorteil und zugleich Nachteil ist die Vergänglichkeit des Baustoffes. Myzelium ist vollständig und ohne Schadstoffe kompostierbar. Biologisch abbaubar bedeutet aber auch: Bei fehlendem Schutz ist die Lebensdauer begrenzt.
Was grundsätzlich möglich ist, zeigt das Projekt "Hy-Fi“: 2014 wird der New Yorker Architekt David Benjamin eingeladen, einen Entwurf für eine MoMA-Ausstellung einzureichen. Er ist fasziniert von der Pilztechnik und möchte diese für einen Turm nutzen. Gemeinsam mit Ecovative, einem Pionier bei der Nutzung von Pilzgeflecht als natürlichen Klebstoff in Verpackungsmaterial, und den Laboren der Columbia Universität lässt er die Myzelien mit Getreidehalmen zu Ziegelsteinen wachsen. Benjamin gewinnt den Ideen-Wettbewerb und baut für das MoMa einen 13 Meter hohen Turm, den ersten Pilzturm der Welt. Der sogenannte „Hy-Fi“ wird nach drei Monaten wieder abgebaut und vermodert rückstandslos zu Kompost.
An der Wasserresistenz sowie der Tragfähigkeit wird weiter geforscht, zum Beispiel am KIT Karlsruhe und der ETH Zürich. 2017 entsteht mit dem Gemeinschaftsprojekt „Myco Tree“ die weltweit erste, lasttragende Struktur aus Pilzmyzelium, die auf der Seoul Biennale of Architecture and Urbanism vorgestellt wird. Das Team kann eindrucksvoll demonstrieren, dass durch eine statisch optimierte Form auch Materialien von verhältnismäßig geringer Festigkeit tragend und raumbildend einsetzbar sind – eine wichtige Grundlage für zukünftige Nutzung von Myzelium als Baustoff.

Blick durchs Grüne: Algenfassade am BIQ in Hamburg. Credit: IBA Hamburg GmbH / Johannes Alt
Alleskönner Algen
Algen bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Bau. So dienen sie beispielsweise als Rohstoff für biologisch abbaubare Kunststoffe und Dämmmaterialien. Mikroalgen wie Spirulina oder Chlorella können durch Biomineralisierung Kalkstein erzeugen, der als Basis für CO₂-reduzierten Zement dient. Algenöle lassen sich in Carbonfasern umwandeln: Leichter als Stahl, aber ähnlich stabil sind sie ideal für tragende Strukturen, Brücken oder Fassadenelemente.
Spannende Ansätze liefern auch algenbasierte Fassadenmaterialen. Bei der Algenbiofilm-Fassade wachsen dünne Schichten aus Mikroalgen auf einem dafür präparierten Untergrund, beispielsweise porösem Beton. Die Biofilme reinigen die Luft und verbessern damit das Mikroklima. Die sogenannten Photobioreaktor-Fassaden beherbergen und kultivieren Mikroalgen in transparenten Glaselementen. Hier betreiben die Algen Photosynthese, wachsen, binden CO₂ und produzieren Biomasse, die energetisch genutzt werden kann. Nachteile? Das Algenwachstum ist witterungsabhängig und noch sind Kosten und Aufwand hoch.
Aber es funktioniert! Mit dem „Bio Intelligent Quotient House“ (BIQ) in Hamburg-Wilhelmsburg wurde 2013 das weltweit erste Gebäude mit bioreaktiver Algenfassade realisiert. Es gilt als wegweisend, weil es Architektur, Biotechnologie und Energieeffizienz verbindet. Neben Sonnenschutz und thermischer Energiegewinnung hat das Haus auch optisch etwas zu bieten: Je nach Algenart, Lichtverhältnissen und Wachstumsphase kann sich die Farbe der Fassade dynamisch verändern – von grün über braun bis hin zu rötlichen Farbtönen. Das macht sie zu einem lebendigen Gestaltungselement.
Übrigens: Im Gegensatz zu klassischen Fassadenbegrünungen benötigen Algenfassaden keinen Bodenanschluss und können auch auf engen, versiegelten Flächen installiert werden – ideal für dichte Innenstädte.
Wie geht es weiter? Es wird weiter geforscht, zum Beispiel zur Algen-Lebendfassade an der RWTH Aachen. Hier geht es um bessere Wärmedämmung und Energieeffizienz von Gebäuden. Aber auch andernorts wird getüftelt und damit alle Forschenden voneinander wissen und lernen können, erfasst die Europäische Kommission mit der „EU4 Algae Project Database“ alle EU-geförderten Algenprojekte.

Genialer Einfall zum Abfall: Aus Resten der Reisproduktion entstehen Gebäudehüllen. Credit: Ricehouse
Vom Abfall zum Wertstoff: Reishülsen
Reishülsen sind ein Nebenprodukt der Reisverarbeitung, das bisher meist als Abfall galt. Kombiniert man sie mit Bindemitteln wie beispielsweise biobasierten Harzen und Zusatzstoffen wie Steinsalz oder recycelten Kunststoffen, entsteht eine Mischung, die sich zu Platten oder Profilen pressen lässt. Die Reishülsenplatten, auch bekannt als „Rice Husk Boards“, können Holz oder Kunststoff am Bau ersetzen.
Die Liste an Vorteilen ist lang: Reishülsen sind extrem widerstandsfähig. Sie enthalten bis zu 20 Prozent Quarz und sind deshalb wasserfest, witterungsbeständig und feuerhemmend und gelten als UV– und schädlingsresistent – ganz ohne Zusätze. Reishülsenplatten sind thermoplastisch, also formbar bei Hitze, und wärmeisolierend.
Im Oktober 2013 traf ein verheerendes Erdbeben die philippinische Insel Bohol. Es beschädigte mehr als 80.000 Häuser und machte 350.000 Menschen obdachlos. Dort entstand das Projekt „Husk-to-Home“, das sich damit befasste, wie man aus Reishülsen stabile, bezahlbare und umweltfreundliche Häuser baut. Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) unterstützte das Projekt im Rahmen ihres P3-Programms („People, Prosperity and the Planet“), das studentische Initiativen für nachhaltige Entwicklung fördert. Durch diese Förderung konnte das Team der „University of California – Riverside“ die Materialforschung vorantreiben und gemeinsam mit lokalen Partnern erste Häuser auf Bohol mit den neuen Platten errichten.
Auch in Europa wird das Potenzial von Reishülsen erkannt. 2016 gründen die Architektin Tiziana Monterisi und Alessio Colombo in Bielle (Piemont, Italien) das Start-up Ricehouse. Das Unternehmen hat sich auf die Nutzung von Reishülsen und weiteren Nebenprodukten der Reisverarbeitung spezialisiert. Heute bietet Ricehouse ein breites Sortiment an Bauprodukten an, darunter Dämmplatten, Putz- und Fassadensysteme.

Guckloch in die Zukunft: Transparentes Holz verbindet natürliche Ästhetik mit intelligenten Funktionen. Credit: holzkurier
Alter Werkstoff neu erforscht: Transparentes Holz
Transparentes Holz ist ein innovativer Werkstoff aus natürlichem Holz, der so behandelt wird, dass er lichtdurchlässig wird. Wie geht das?
Fichte, Birke oder Balsaholz haben eine geringe Dichte und eine gleichmäßige Struktur. Deshalb eignen sie sich besonders gut. Zunächst wird das Holz in dünne Schichten geschnitten und dann in Wasserstoffperoxid eingelegt. Es eignen sich auch andere Flüssigkeiten, die dem Holz das Lignin entziehen. Denn das Lignin ist es, dass das Holz lichtundurchlässig macht.
Übrig bleibt ein weißliches, poröses Holzgerüst aus Zellulose, das im nächsten Schritt mit einem transparenten Polymer, zum Beispiel Epoxidharz, imprägniert wird. Durch Hitze oder UV-Licht verfestigt sich der Werkstoff zu einem festen, transluzenten Material mit erstaunlichen Eigenschaften.
Transparentes Holz ist bruchsicherer und leichter als Glas und damit ideal für erdbebensichere Gebäude oder tragende Strukturen. Die Lichtstreuung sorgt für natürliche, blendfreie Beleuchtung – und das bei einer Lichtdurchlässigkeit von bis zu 85 Prozent. Es hat darüber hinaus bessere Isoliereigenschaften als Glas, was es besonders für energieeffiziente Gebäude attraktiv macht. Dabei bleibt die Struktur des Holzes erhalten und vereint so mechanische Stabilität mit natürlicher Ästhetik.
Der Durchbruch bei der Erforschung von transparentem Holz gelang 2016 an der Königlich-Technischen Hochschule Stockholm (KTH). Seither wird weltweit an Pilotprojekten und Prototypen gearbeitet.
Perspektivisch könnte transparentes Holz sogar Trägermaterial für Solarzellen sein – und damit Fenster in Stromquellen verwandeln. Auch für Smart-Technologien gibt es erste Ansätze, bei denen der Werkstoff mit Temperaturregelung oder Lichtsteuerung kombiniert wird.
Doch es bleiben Herausforderungen. Die Entfernung des Lignins erfordert chemische Prozesse, die energieintensiv und nicht immer umweltfreundlich sind. Auch das Recycling ist schwierig, denn die Kombination aus natürlichem Holz und synthetischen Polymeren erschwert die Trennung der Materialien und damit deren Wiederverwertung.

Bakterien machen’s möglich: Beton lernt, sich selbst zu reparieren. Credit: College of Engineering and Applied Science at Colorado University Boulder
Selbstheilender Beton: Die Zukunft des Bauens beginnt zu wachsen
Beton ist stark, vielseitig und aus unserer Welt kaum wegzudenken – doch wenn er Risse bekommt, wird’s teuer und aufwendig. Wie wäre es, wenn Beton so clever wäre, sich selbst zu reparieren – ganz ohne Handwerker und Baustelle?
Selbstheilender Beton macht’s möglich. Um den Prozess der Selbstheilung bei Bedarf auszulösen, werden dem klassischen Beton während der Produktion Zusätze beigemischt. Das können Bakterien sein, die bei eindringendem Wasser Kalkstein produzieren und damit Risse bis maximal 0,5 Millimeter verschließen (biologisch selbstheilender Beton).
Eine andere Möglichkeit sind Mikrokapseln, die beispielsweise mit Epoxidharz oder Silikaten gefüllt sind. Entstehen Risse, platzen die Kapseln auf, die Substanz füllt Hohlräume und härtet aus (kapselbasierter Ansatz). Bei mineralischem selbstheilendem Beton werden Zusatzstoffe wie Kristallisationsmittel eingebracht, die bei Wasserkontakt reagieren, neue Kristalle bilden und damit Risse im Bauwerk schließen.
Auch wenn die Zusatzstoffe und die komplexe Produktion die Herstellungskosten um bis zu 50 Prozent erhöhen – die Vorteile selbstheilenden Betons liegen auf der Hand: Tunnel, Brücken, Staudämme, Tiefgaragen, Parkhäuser und andere Bauten können über eine längere Zeit und zu geringeren Kosten instandgehalten werden. Sie „leben“ länger und bieten uns mehr Sicherheit.
Die Tatsache, dass Bakterien geduldig sind und im Ruhezustand bis zu 200 Jahre auf ihren Einsatz warten können, trägt dazu genauso bei wie die Eigenschaft einiger Betone, mehrmals heilen zu können.
Pilot- und Forschungsprojekte gibt es bereits: Die Technische Universität im niederländischen Delft erbaute 2015 eine mobile Fußgängerbrücke, um diesen neuartigen Beton zu zeigen und die Bakterien-Technologie zu testen. Ebenfalls in den Niederlanden, in Apeldoorn, wurde 2017 ein Parkhaus mit bakterienbasiertem Beton fertiggestellt. Es war eines der ersten größeren Praxisprojekte, die mit dem von der TU Delft entwickeltem Beton realisiert wurden. In ganz Europa gibt es denkmalgeschützte Bauten, an denen mikrobieller Mörtel getestet wird. Namen konkreter Bauwerke sind öffentlich nicht bekannt, aber in der Forschung wird immer wieder das Parthenon in Athen erwähnt.
Und wie geht es weiter? Beton soll sich nicht nur selbst heilen können, sondern auch intelligent werden: Forschende arbeiten daran, ihm Sensoren oder smarte Materialien beizufügen, die den aktuellen Zustand eines Bauwerks überwachen und melden können. Für mehr Sicherheit und weniger Baustellen.
Bauen ohne Beton: Weniger Grau, mehr Wow
Während herkömmlicher Beton und Stahl die Baustellen der Welt noch dominieren, stehen die oben genannten und weitere spannende Baustoffe in den Startlöchern: Ferrock, das CO₂ bindet statt ausstößt, Bambus, der schneller wächst als wir „Betonmischer“ sagen können, und Hanfbeton, der nicht nur nachhaltig, sondern auch überraschend stylisch ist.
Wir stehen an einem Wendepunkt. Die Baustoffe der Zukunft sind nicht nur grün, sie sind clever, lebendig, manchmal sogar selbstheilend – und sie fordern unsere Vorstellungskraft heraus. Bauen wird anders. Die Risse im System sind sichtbar – und diesmal ist das eine gute Nachricht.

Myzelium kann in nahezu jede Form wachsen Mycelium
Myzelium ist das unterirdische Wurzelgeflecht von Pilzen – ein Netzwerk aus feinen Fäden, das auf organischem Abfall wächst. Unter kontrollierten Bedingungen kann es in nahezu jede Form wachsen und sorgt damit bei Umweltpionieren, Architekten und Designern gleichermaßen für Begeisterung.
Algen erzeugen Kalkstein durch Biomineralisation Algen
Algen bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Bau: sie können durch Biomineralisierung Kalkstein erzeugen, der als Basis für CO₂-reduzierten Zement dient, oder lassen sich in Carbonfasern umwandeln, die leichter als Stahl sind, aber ähnlich stabil.
Reishülsen Reishülsen
Reishülsen sind ein Nebenprodukt der Reisverarbeitung. Kombiniert man sie mit Bindemitteln wie biobasierten Harzen und Zusatzstoffen wie Steinsalz oder recycelten Kunststoffen, entsteht eine Mischung, die in Form von Reishülsenplatten Holz oder Kunststoff am Bau ersetzen kann.
Transparentes Holz Transparentes Holz
Transparentes Holz ist bruchsicherer und leichter als Glas. Zunächst wird dem Holz das Lignin entzogen. Das übrig bleibende Holzgerüst aus Zellulose wird mit einem transparenten Polymer imprägniert. Es entsteht ein festes, transluzentes Material mit erstaunlichen Eigenschaften.
Selbstheilender Beton Selbstheilender Beton
Um den Prozess der Selbstheilung bei Bedarf auszulösen, werden dem Beton während der Produktion z.B. Bakterien beigemischt, die bei eindringendem Wasser Kalkstein produzieren und damit Risse bis maximal 0,5 Millimeter verschließen.
Diese Seite wurde im November 2025 veröffentlicht.

Antje Schmaus
… ist immer auf der Suche nach spannenden Fakten und Formaten, um Kolleginnen und Kollegen weltweit zu begeistern. Für sie ist „Wohnen im Einklang mit der Natur“ nicht nur ein absoluter Wohlfühlfaktor, sondern die Grundlage für die Zukunft nachhaltigen Bauens.
Empfohlene Inhalte
Wachstum mit Verantwortung | Standpunkt
„Der Elefant im Klimaraum” „Der Elefant im Klimaraum”
Philipp Misselwitz hat eine Vision: Der Bausektor soll künftig das Klima schützen, statt ihm zu schaden. Wie das gehen soll, verrät er im Interview.
„Der Elefant im Klimaraum” Bauhaus Erde entdeckenWachstum mit Verantwortung | Quiz
Quiz: Baust du noch oder staunst du schon? Quiz: Baust du noch oder staunst du schon?
Wie zukunftsfähig ist dein Wissen über das Bauen von morgen? Teste dein Know-how über spannende Materialien und finde heraus, ob du schon weiterdenkst als andere.
Quiz: Baust du noch oder staunst du schon? Jetzt Wissen testen!Wachstum mit Verantwortung | Kurz & knapp
Mehr als nur Fassade: Die „grünen“ Gebäude der Deutschen Bank Mehr als nur Fassade: Die „grünen“ Gebäude der Deutschen Bank
Von stromerzeugenden Aufzügen in Frankfurt bis zu einer Oase in London: So gestaltet die Bank die Zukunft des Bauens und Arbeitens mit.
Mehr als nur Fassade: Die „grünen“ Gebäude der Deutschen Bank Mehr als nur Fassade